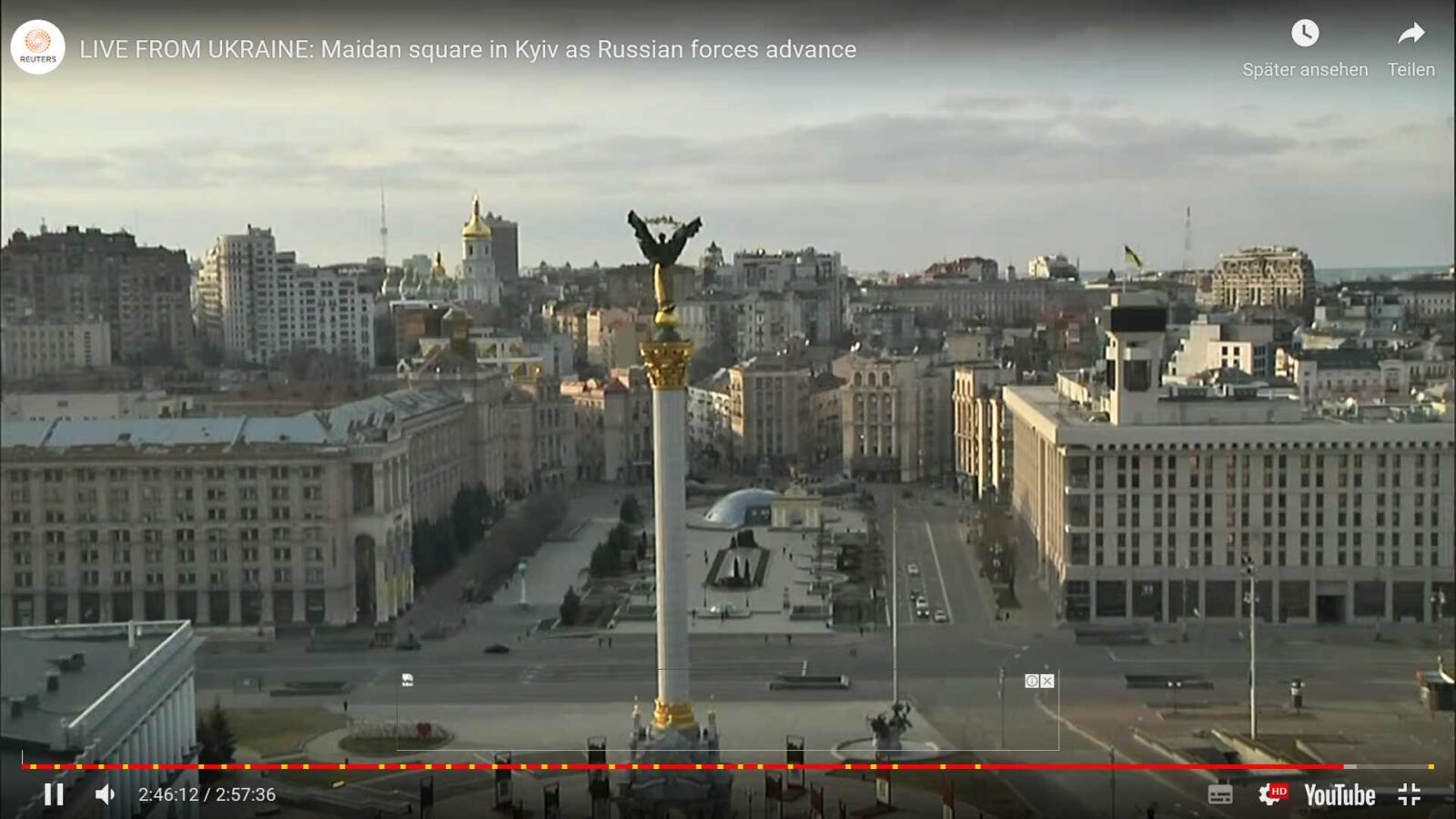Seit gestern stehe ich neben mir. Um mich herum ist zwar alles wie immer und auch an der normalen, täglichen Routine, mit der ich mich durch zwei Pandemiejahre gebracht habe, hat sich nichts verändert.
Trotzdem beherrscht mich dieses Gefühl, das ich erst erfolglos mit viel Doomscrolling einzuhegen versuchte – und dem ich heute mit zwei Podcasts wenigstens ansatzweise auf die Schliche gekommen sind: Zum einen hat Tamedia-Ausland-Chef Christof Münger im «Apropos»-Podcast meines Arbeitgebers eine Einschätzung vorgenommen und zum anderen fand ich Ulrich Schmids Einordnungen im «Tagesgespräch» von Radio SRF hilfreich. Schmid ist Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen.
Ich habe ausserdem dünnhäutig auf einen Tweet von Sascha Lobo reagiert, weil der sonst zwar den Ton häufig ganz genau trifft, dieses Mal aber empathielos und utilitaristisch rüberkam.
Dann warte ich auf eine Kolumne von dir, mit der du Putin aus dem Kreml schreibst. Wenn du schon dabei bist: Schreib doch das Wort Weltfrieden rein, dann hätten wir das auch erledigt.
— Matthias Schüssler (@MrClicko) February 25, 2022
Ferner würde ich mich gern dem Furor anschliessen, mit dem Réda el Arbi auf den Bundesrat losgeht, weil der sich um eine klare Haltung herumdrückt.
Nazi-Deutschland, das Apartheids-Südafrika und jetzt Russland.
You name it.
Die Schweiz bleibt sich treu, was das Blutgeld von Drecksäcken angeht.
Auch dieser Bundesrat wird mit einem Sack voll Dreck auf dem Gewissen in die Geschichte eingehen.
— reda el arbi (@redder66) February 24, 2022
Dafür muss ich erst den ersten Schock überwinden und die nötige Energie mobilisieren – aber die nötigen Fakten, warum man auch als neutrales Land mehr Cojones zeigen könnte, habe ich schonmal beieinander. Die gibt es in einem weiteren Podcast, «Politbüro», von den Tamedia-Journalistinnen Raphaela Birrer und Markus Häfliger.
Es aushalten oder abschalten?
Immerhin hatte ich genügend Kraft, um zumindest punktuell gegen den Unsinn anzugehen, der Putinversteher Roger Köppel und seine «Weltwoche» derzeit verbreiten.
Ihr hingegen sendet live aus Putins Enddarm. pic.twitter.com/HLeyXyZ36G
— Matthias Schüssler (@MrClicko) February 24, 2022
Ist Twitter eine sinnvolle Beschäftigung, um den Realitätsschock zu verdauen oder wäre jetzt eine so gute Gelegenheit wie selten für eine Social-Media-Auszeit? Ich neige dazu, Twitter (im Gegensatz zu Facebook) für nützlich zu halten – und das, obwohl man auf Schritt und Tritt einem Unfug begegnen kann, der einem den Puls auf 180 treibt und an der Menschheit zweifeln lässt.
Und ich dachte, das Dümmste, was mir heute begegnet, wäre das Editorial von @KoeppelRoger gewesen. https://t.co/kh8aasrQIY
— Matthias Schüssler (@MrClicko) February 24, 2022
Solche Tweets sind indes leichter zu verkraften als jene Posts, die durch hundert- oder tausendfaches Retweeten aus der Ukraine in hiesige Timelines gelangen. Auch wenn man nie weiss, ob Propaganda oder Inszenierung dahintersteckt, so schaffen sie es auf direkte Art, das abstrakte Bedrohungsgefühl in realen Horror zu verwandeln – eine Wirkung, die kein anderes Medium so unmittelbar auslöst.
A Ukrainian father says goodbye to his family, while he stays behind to fight the Russians😭#Ukraine #StopWar pic.twitter.com/g3DuFKM5Op
— Lil (@lil_whind) February 24, 2022
Fragment für Fragment entfaltet sich die Wirklichkeit
Diese Form des Miterlebens hat «Wired» im Beitrag News From Ukraine Is Unfolding in Fragments Over Social Media aufgearbeitet. Es hat mich an Jan Böhmermanns Kritik am Instagram-Projekt Ich bin Sophie Scholl erinnert.
Ich teile die Kritik, und im Licht der letzten zwei Tage wirkt der Medienbruch noch befremdlicher.