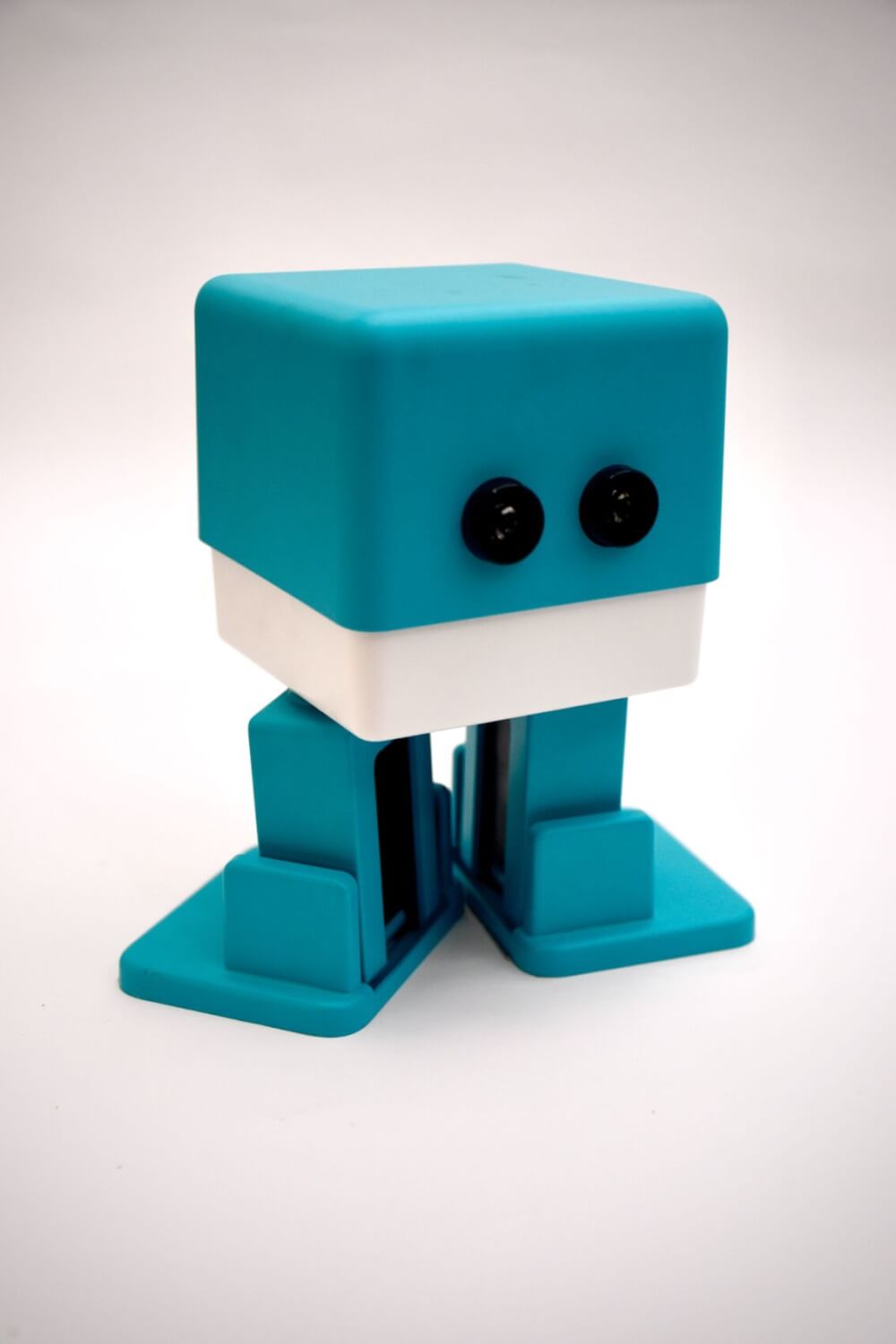Ich habe mit mir gehadert, ob ich den heutigen Blogpost schreiben soll. Denn es soll darin um einen Podcast gehen, der von meinem Arbeitgeber stammt und in dem ich auch schon einen Auftritt hatte (Warum Facebook uns gerade jetzt eine neue virtuelle Welt verspricht). Die Gefahr ist unvermeidlich, dass meine Empfehlung als parteiisch erscheint. Dieser Gefahr setze ich mich nicht gerne aus, denn dieses Blog hier soll weiterhin als unabhängig wahrgenommen werden – weil es das schliesslich auch ist.
Vielleicht bin ich auch übervorsichtig. Man ist nicht automatisch ein PR-Instrument, wenn man nicht wenigstens ein paar der Produkte seines Arbeitgebers gut finden würde. Nein, wenn man an ihnen überhaupt keinen Gefallen findet, sollte man schnellstens den Job wechseln. Der Ausschlag gegeben hat für mich, dass ich den Podcast nicht nur theoretisch eine vielversprechende Idee finde, sondern ihn seit einiger Zeit regelmässig höre, und zwar nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern, weil ich ihn spannend und aufschlussreich finde.
Also, nach dieser wohlabgewogenen Erklärung sei gesagt, wenden wir uns dem Thema zu:

Es geht um den Podcast Apropos (RSS, iTunes, Spotify, Google), der am 29. März 2021 gestartet wurde. Er erscheint täglich, und in der Ankündigung seinerzeit hiess es noch, er solle eine Viertelstunde lang sein. Heute sind es eher zwanzig Minuten, doch die magische zeitliche Ausdehnung ist bei Podcasts absolut die Regel und nicht die Ausnahme. Und wenn er nur um ein Drittel länger wird, ist das noch verkraftbar. Ich erinnere mich an Produktionen, die erst eine Stunde und ein halbes Jahr später fünf Stunden dauerten.
Er wird von Tamedia-Podcast-Produzentin Mirja Gabathuler, unserer Podcast-Spezialistin, und von Inlandredaktor Philipp Loser betreut, erscheint täglich und lebt von der Idee, zu einem tagesaktuellen Artikel Zusatzinformationen oder eine Art Making-of zu liefern: Einer der beiden Macher:innen führt ein Gespräch mit einer Journalistin zu einem Thema, über das sie gerade geschrieben hat (oder er, falls es ein Mann war).
Die grosse Bandbreite an Themen und Leuten
Mir gefällt dieses Format. Erstens ist es hübsch produziert, oft mit O-Tönen. Zweitens bildet es die Vielfalt der Themen ab, mit der wir es in unserem Haus zu tun haben. Die bekomme ich nicht mal als Redaktionsmitglied im vollen Umfang mit, wie das in einem grossen Haus üblich ist; besonders während einer Pandemie mit Homeoffice, wo die Gelegenheit flachfällt, sich wenigstens ab und zu in den Fluren oder dem Newsroom zu begegnen.
Drittens ist ein Podcast ein wunderbares Gegenstück zu unserer hektischen Website. Die zeichnet sich dadurch aus, dass viele Stücke um die Aufmerksamkeit buhlen, wobei die Halbwertszeit oft gering ist. Das bildet die sich oft rasant entwickelnde Nachrichtenlage ab, aber es trägt meines Erachtens auch zum Eindruck bei vielen Medienkonsumenten bei, Nachrichten seien nur noch eine Ware, die in möglichst grossen Mengen umgeschlagen werden müsse. Das wiederum könnte mit ein Grund sein, weswegen man oft die Einschätzung hört, Journalismus sei oberflächlicher und klickorientierter geworden – und wir, die ihn machen, seien Getriebene, die nur noch ihren Leistungsvorgaben hinterherhetzen.
Der Podcast zeigt ein anderes Bild auf: Man hört hier Journalistinnen und Journalisten, die sich in ihre Themen reinknien. Sie haben zwar nichts dagegen, wenn ihre Artikel auch gut gelesen werden, aber das allein taugt als Motivation für den Job nicht: Es braucht eine Leidenschaft für die Themengebiete, eine aufklärerische Ader, ein Sendungsbewusstsein – wie auch immer man das nennen will.
Der Mythos der Graswurzelbewegung
Dieser Umstand kommt im Podcast voll zum Tragen. Und wenn sich das nun trotz meiner eingangs erwähnten Unabhängigkeitserklärung etwas nach Laudatio auf meinen Arbeitgeber anhören mag, so geht es mir nicht darum. Wichtig ist mir die Erkenntnis, dass der Podcast seine grösste Stärke auch dann nicht verliert, wenn er nicht als Graswurzelbewegung, sondern als Produkt eines grossen Medienunternehmens entsteht.
Das ist nicht selbstverständlich, denn in seiner Anfangszeit 2006 war das Podcasting ein alternatives Medium. Es verstand sich explizit als Gegenstück zu den etablierten Newsplattformen und hat diesen Entstehungsmythos – dass man angetreten ist, um die Medien zu demokratisieren – auch nach Kräften gepflegt.
Ich habe bis vor ein paar Jahren nicht daran gezweifelt, dass das stimmt, obwohl ich es hätte besser wissen können. Denn die Bemerkung, dass Roger Zedi und ich ab 2006 den Digitalk – und damit den allerersten Tamedia-Podcast – produziert haben, kann ich mir an dieser Stelle natürlich nicht verkneifen. Aber was wir und viele der Ur-Podcaster damals nicht verstanden haben, ist die Tatsache, dass die eigentliche Stärke des Podcasts darin liegt, Geschichten auf einer persönlichen Ebene zu erzählen – und das ist auch für grosse Medienhäuser eine riesige Chance zu zeigen, dass dort nicht alles Newsroboter arbeiten, sondern richtige Menschen…
Beitragsbild: Ein Newsroboter, erkennbar am eckigen Kopf (Everyday basics, Unsplash-Lizenz).