Eigentlich geht es an dieser Stelle nie um Sachbücher – sondern um zukunftsträchtige, fantastische oder technikverliebte Fiktion. Heute mache ich eine Ausnahme. Es geht um Talking to Strangers von Malcolm Gladwell (Amazon Affiliate); in Deutsch Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden.
Es gibt zwei gute Gründe, dieses Buch zu besprechen. Erstens, weil der Mann einen interessanten Sachverhalt aufwirft. Und zwar einen, das interessanter ist, als man angesichts des Titels denken würde. Ich hatte anfänglich vermutet, dass der Gladwell herumgeht und in Kneipen und auf Banhöfen x-beliebige Leute anquatscht.
Aber nein, natürlich hat einer, der bei der Kult-Zeitschrift «The New Yorker» gearbeitet und sich dort eine grosse Fangemeinschaft erarbeitet hat, höhere Ansprüche als der typische Lokalreporter, der eine Themenlücke zu füllen hat – und tut, was Lokalreporter in solchen Situationen schon immer getan haben (nämlich eine Strassenumfrage zu machen). Es geht im Buch mit dem Untertitel «What We Should Know about the People We Don’t Know» um die Kommunikationsprobleme, die mit unbekannten Menschen auftreten.
Warum kommt es zu fundamentalen kommunikativen Missverständnissen, die so gross sein können, dass Menschen bei solchen ersten Begegnungen zu Tode kommen? Gladwell beginnt diese Frage bei einer afroamerikanischen Frau namens Sandra Bland, die in einem Kaff in Texas von einem Autobahnpolizisten wegen einer Nichtigkeit angehalten wird.
Wenn Fremde aufeinandertreffen, ist die Gefahr von Missverständnissen gross
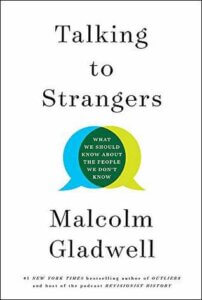 Die Sache eskaliert, sodass die Frau verhaftet wird und sich drei Tage später in der Gefängniszelle das Leben nimmt. Das hat natürlich kontroverse Folgen: Die einen schreien Rassismus. Die anderen verweisen darauf, dass solche Fälle immer komplizierter sind, als man von aussen sieht – und dass es deswegen zu einfach wäre, den Fall auf «weisser, übergriffiger Cop und schwarzes Opfer» zu reduzieren.
Die Sache eskaliert, sodass die Frau verhaftet wird und sich drei Tage später in der Gefängniszelle das Leben nimmt. Das hat natürlich kontroverse Folgen: Die einen schreien Rassismus. Die anderen verweisen darauf, dass solche Fälle immer komplizierter sind, als man von aussen sieht – und dass es deswegen zu einfach wäre, den Fall auf «weisser, übergriffiger Cop und schwarzes Opfer» zu reduzieren.
Gladwells These ist, dass beide irgendwie recht haben. Wenn Fremde aufeinandertreffen, tun Sie das nicht immer auf gleicher Augenhöhe, mit ähnlichen Absichten oder gegenseitiger Transparenz. Zur Erklärung holt der Autor weit aus. Er weist nach, dass wir Menschen äusserst schlecht darin sind, Lügner zu erkennen – und zwar deswegen, weil das Zusammenleben nur dann funktioniert, wenn wir gewillt sind, unseren Mitmenschen Ehrlichkeit zu attestieren. Er erklärt die Illusion of asymmetric insight, die uns dazu bringt zu glauben, dass wir andere besser beurteilen können als andere uns. Und er legt dar, dass der persönliche Kontakt zu viel grösseren Fehleinschätzungen führen kann, als wenn man jemanden aus der Ferne, nur aufgrund seiner Taten beurteilt.
Von oben bis unten eingeseift
Ein Beispiel dafür ist Neville Chamberlain, der von 1937 bis 1940 Premierminister des Vereinigten Königreichs war. Er hat es als seine Aufgabe angesehen, sich mit Hitler zu treffen und sich im Gespräch ein Bild von dessen Plänen zu machen. Hitler hat ihn von oben bis unten eingeseift. Chamberlain war der Meinung, es mit einem Ehrenmann zu tun zu haben. Andere seiner Landsleute, zum Beispiel Winston Churchill hatten Informationen nur aus zweiter Hand (oder aus Quellen wie «Mein Kampf») und liessen sich nicht täuschen.
Das passiert auch anderen: Gladwell zeigt auf, dass Richter oft weit daneben liegen, wenn Sie die Rückfallgefahr eines Delinquenten beurteilen müssen. Sie lassen sich von überzeugend vorgetragenen Ausreden täuschen, sodass Leute gegen Kaution auf freien Fuss gesetzt werden, die eigentlich eingesperrt werden müssten. Ein Algorithmus, der rein aufgrund der Akten entscheidet, fällt demnach signifikant bessere Urteile.
Wir können Lügner nicht erkennen, sind zu wohlwollend mit Leuten und kennen uns mit fremden Ausdrucksformen viel zu wenig aus, sodass wir die Gefühlsregungen von Menschen aus anderen Kulturkreisen fundamental falsch bewerten.
«Pseudointellektuelle Pirouetten»
Klar – das ist alles nicht völlig überraschend. Das findet auch der Rezensent von «The Guardian», der dem Autor pseudointellektuelle Pirouetten vorwirft und sagt, er würde Banalitäten breittreten:
Wenn Sie das alles überrascht, dann befinden Sie sich in bester Gesellschaft, denn es überrascht auch Malcolm Gladwell, dessen Job es ist, sich von Banalitäten in Erstaunen versetzen zu lassen und sie dann, nach einem grossen pseudointellektuellen Rundgang, durch Banalitäten zu ersetzen. Gladwell findet es verblüffend, wie wir Menschen, die wir nicht kennen, so falsch einschätzen können. Also nennt er es «das Problem der Fremden» und tut so, als ob es alles erklärt.
Das kann man tatsächlich so sehen. Nichts ist neu – auch nicht die Erkenntnis, dass wir unter Alkoholeinfluss unsere Urteilskraft verlieren. Trotzdem habe ich das Buch nicht als Zeitverschwendung erlebt. Gladwell rollt viele interessante Fälle auf: Nebst demjenigen von Sandra Bland geht es auch um den College-Studenten Brock Turner, der im Suff eine Kommilitonin vergewaltigt haben soll. Gladwell fragt, warum keinem dem Pyramidenbetrüger Bernie Madoff auf die Schliche gekommen ist, obwohl es Verdachtsmomente genug gab.
Und wie war das mit Chalid Scheich Mohammed, der unter Folter die ungeheuerlichsten Al-Qaida-Attentatspläne gestanden hat? Er geht dem Suizid der Poetin Sylvia Plath nach und erklärt, wie sich die italienischen Ermittungsbehörden bei Amanda Knox getäuscht haben, weil die sich halt einfach nicht so verhalten hat, wie man es als unschuldige Frau getan hätte. Zur Erinnerung: Knox war angeklagt, ihre Freundin Meredith Kercher umgebracht zu haben.
Das mit «Friends» wussten wir schon
Und ja, die These des Buchs ist tatsächlich reichlich plakativ und etwas platt: Das Leben ist halt nicht so schwarzweiss wie die Fernsehserie «Friends», sagt Gladwell einmal, was ihm «The Guardian» dann genüsslich um die Ohren haut.
Aber ich bin grosszügiger: Es ist okay, auch Dinge zu beleuchten, die niemanden mit gesundem Menschenverstand und etwas Lebenserfahrung aus den Latschen hauen – wenn man es so unterhaltsam und detailverliebt tut wie Gladwell. Und wenn man sich nicht von den Erkenntnissen selbst verblüffen lassen will, dann kann man Gladwell den einen oder anderen Taschenspielertrick abschauen. Denn unterhaltsam ist der Mann – und er weiss, wie man ein Thema in grossen Bögen einkreist.
Und ich hatte ja zwei gute Gründe versprochen, weswegen ich das Buch bespreche. Der zweite Grund ist tatsächlich ein formaler. Ich halte Gladwell für einen hervorragenden modernen Storyteller. Seinen Podcast «Revisionist History» habe ich bei früherer Gelegenheit besprochen. Dort operiert er fast identisch – und mitunter mit Erkenntnissen, die tatsächlich kontraintuitiv sind.
Das Hörbuch ist wie ein Podcast produziert
Das Hörbuch von «Talking to Strangers» wird von Gladwell selbst gelesen – und es ist produziert wie ein moderner Podcast: Mit Ausschnitten aus den Interviews, O-Tönen und Musik. Und ich bin überzeugt, dass Gladwell hier einen Trend vorwegnimmt: Der Podcast wird das Hörbuch, zumindest im nichtfiktionalen Bereich verändern und prägen. Und das ist doch was – nachdem ich schon hier erklärt habe, warum er zu einer eigenständigen Erzähform herangereift ist.
Beitragsbild: Er könnte ein Liedchen davon singen (Jacqueline Macou/Pixabay, Pexels-Lizenz)
