Ein Ding, das ich wirklich nicht verstehe, ist das Konzept der Musikrotation im Radio. Musikrotation – das ist eigentlich nur ein schönes Wort für: Immer und immer wieder der gleiche alte Scheiss. Ich habe deswegen aufgehört, SRF3 zu hören.

Hier könnte der Blogpost zu Ende sein, wenn der Sender nicht gezwungenermassen an mein Ohr dränge, weil ihn die Gattin gerne einschaltet. Und dann geht mir schon wieder der Hut: Zum Hunderttausendsten Mal «Männer» von Herbert Grönemeyer, «Love Shack» von den B52’s, Die Toten Hosen mit «Tage wie diese», Jamiroquai mit «Virtual Insanity», Kylie Minogue mit «Can’t Get You Out Of My Head», Texas mit «Black Eyed Boy», Outkast mit «Ms. Jackson», Plain White T’s mit «Hey There Delilah». Und wenn es hochkommt, folgen Bruno Mars und die Backstreet Boys.
Allergisch auf Redundanz
Abgesehen von den letzten beiden kann ich allen aufgezählten Interpreten etwas abgewinnen. Das heisst aber nicht, dass ich sie ständig hören will. Ich will sie bei weitem nicht so oft hören, wie sie gespielt werden. Vielleicht bin ich besonders allergisch auf Redundanz.
Mag sein. Selbst meine allerliebsten Songs spiele ich nicht zu oft, weil ich sie nicht tothören will. Aber selbst wenn ich diesbezüglich eine untypisch niedrige Toleranzschwelle haben sollte, verstehe ich diese Formel nicht, die dazu geführt hat, dass ich in diesem und im nächsten Leben wirklich keinen einzigen Song von Tina Turner mehr hören will und Phill Collins in die E***r treten würde, wenn ich ihm zufällig auf der Strasse begegnen würde. Obwohl der arme Mann nichts dafür kann, dass die beim Radio so einfallslos sind.
Tina Turner ist ein gutes Beispiel dafür. «Simply the Best», «What’s Love Got to Do with It», «Private Dancer» sind verbrannt für alle Zeiten. Sogar «Nutbush City Limits», obwohl das eigentlich ein cooler Song wäre. Das Radio – und ja, ich meine dich SRF3! – ist dabei, mir auch Queen, Zucchero, Prince und Tracy Chapman kaputtzumachen.
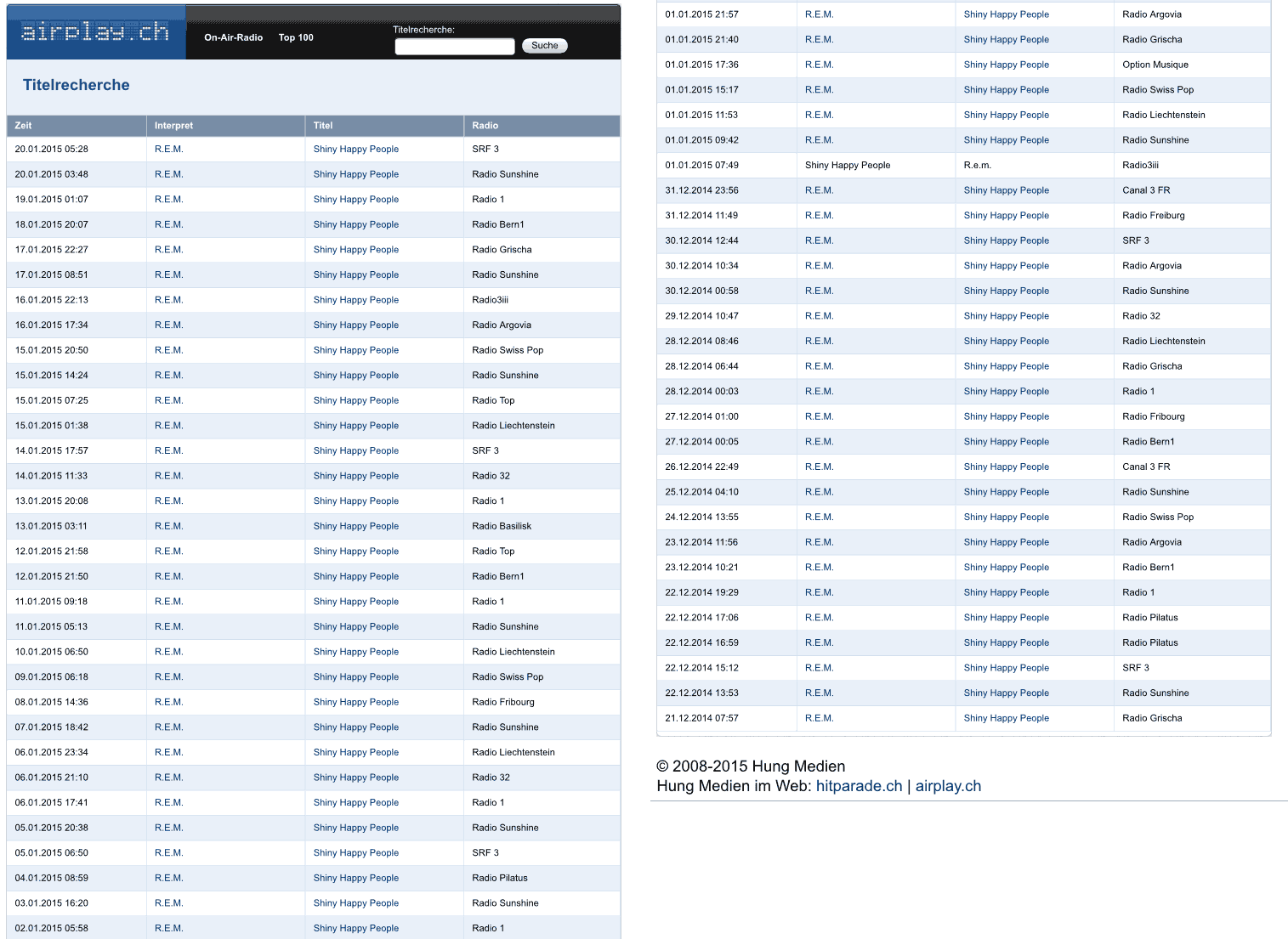
Auf SRG Insider schreibt Marceline Iten, die Musikauswahl im Radio sei ein Spiel mit den Emotionen. Der Beitrag fängt mit der Standardausrede bei diesem Thema an, nämlich «dass man es nie allen recht machen» könne. Und trotzdem versucht man genau das:
Bei den Radiostationen von SRF sieht es bezüglich der Hörerzufriedenheit nicht anders aus [als bei den Privatsendern]. Sie steht an oberster Stelle.
Und dabei ist eben die Schwierigkeit…
… den Hörer nicht zu verstimmen und ihn nicht mit neuer Musik zu überrollen, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ihn zufrieden zu stellen und gleichzeitig Neues vorzustellen, ist eine Herausforderung.
Kläglich gescheitert
An dieser Herausforderung ist die SRG kläglich gescheitert. Ich bin weder zufrieden, noch hätte ich in den letzten Jahren einen einzigen Künstler dank der SRG entdeckt. Neue Musik entdecke ich durch Fernsehserien wie «Breaking Bad», durch Spotify und natürlich auch durch meine Arbeit bei Radio Stadtfilter.
Bei der Förderung der Musikvielfalt hat die SRG meines Erachtens ihre Daseinsberechtigung verloren. Das stelle ich mit einer gewissen Bitterkeit und grossem Bedauern fest, denn ich war nach dem Sendestart von DRS3 ein eingefleischter Fan. Der «amtl. bew. Störsender» hat meine Jugend und mein musikalisches Weltbild geprägt. Doch heute verbannt man die interessante Musik in die Randzeiten und die «Specials», wo ich und viele andere kein Radio hören. Wenn ich am Morgen SRF3 höre, dann köchelt die die Mainstream-Suppe – und wenn jede Stunde mal Plüsch mit «Wunder passiere» oder Stiller Has läuft, dann ist das nicht das, was ich Förderung des Musikschaffens und Service Public verstehen würde.
Die Ursünde des Radios war – und das sage ich als bekennender Nerd und Computerfreak – dem Computer die Musikauswahl zu überlassen. Die Auswahlalgorithmen befördern den Mainstream und die Einheitssosse, vor allem, wenn sie dem im Artikel Dem Hörer ein guter Freund sein geäusserten Anspruch eingesetzt werden:
Wenn jemand ohne hinzuschauen das Radio einschaltet, muss er spätestens nach zwei Songs erkennen, dass er oder sie den Lieblingssender hört.
So wird im Beitrag Michael Schuler, der Leiter Fachredaktion Musik von SRF, zitiert. Wenn dem so wäre, könnten die Sender darauf verzichten, nach spätestens jedem zweiten Song eine Station-ID zu spielen. Und es ist eben so, dass bei der Auswahl Prägnanz, Relevanz und die Erfahrung eines Musikredaktors keine Rolle spielen:
Die Auswahl (…) ist das Ergebnis eines ausgeklügelten, kontinuierlichen Verfahrens, bei dem es weniger auf den persönlichen Musikgeschmack der Verantwortlichen ankommt, sondern ausschliesslich auf deren Interpretation von Studien aus der Marktforschung und der Wissenschaft.
Auf Algorithmen und Marktforschung sch…!
Algorithmen und Marktforschung. Ein Rezept, das für alle Sender gilt, ob gebührenfinanziert oder privat. Sie alle schielen nach dem Mainstream. Sie haben die gleichen Berater, ähnliche Softwareprogramme und können vielleicht die Parameter noch etwas variieren. Das ist das Gegenteil von gutem Radio. Gutes Radio wird von Leuten gemacht, die Geschmack und Charakter haben, und die auf Algorithmen und Marktforschung sch…!
PS: Ich entschuldige mich, dass nach dem gestrigen Beitrag schon wieder ein Posting mit Verbalinjurien das Licht des Web erblickt. Es wird wieder gesitteter werden, versprochen!
Ich kann nach zwei Songs nicht wirklich erkennen, ob ich jetzt Frisky Radio, Deep Mix Moscow Radio oder electronicmusic.fm höre. Just kiddin’…
Ich habe aufgrund dieses Heavy-Rotation-Mülls (von altem, mittelaltem und neuem Mainstream, je nach Sender) mich vollständig vom “klassischen” Radio verabschiedet. Ich könnte jetzt einen laangen Rant anfangen, dass Radio früher viel besser war (stimmt eigentlich gar nicht, wie haben lieber BFBS anstatt NDR2 oder DRS3 – um wieder on-Topic zu werden – anstatt SWF3 gehört). Neue Musik im Radio? Ja, hatte ich zuletzt in der “Netzparade” auf DasDing. Warum sich aber mit der Zweitverwertung im “klassischen” Radio abgeben, wenn man direkt im Internet neue Musik finden kann?
Das wirklich Bittere an der ganzen Geschichte ist aber, dass wir hier in Deutschland (und ihr in der Schweiz auch) für so etwas Zwangsgebühren abgepresst bekommen.
Radio darf kein Produkt sein. Es ist ein Kulturgut, besonders wenn es von der Allgemeinheit durch Gebühren bezahlt wird.